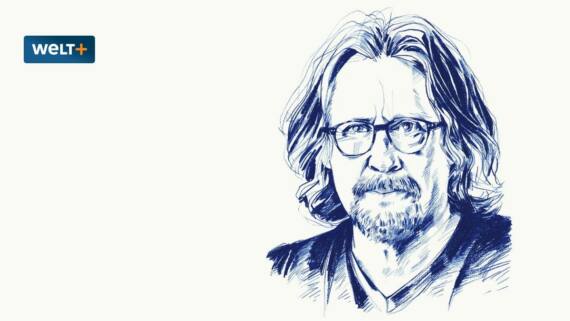Täglich, monatlich oder doch nur einmal im Jahr – wie oft schauen Sie auf Ihren Stromzähler? Und sollten Sie es häufiger tun? Einmal jährlich fragen […]
Die neueste Umfrage zeigt, dass die Union an Zustimmung verliert, während die FDP sich auf fünf Prozent verbessert. Die CDU und CSU verlieren jeweils einen […]
Die Inflation treibt die Preise in die Höhe. Auch die von Eiern. Lohnt es sich also, selbst Hühner zu halten, um Geld zu sparen? Um […]
Bei der Konferenz in Kairo forderte Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, sowohl die Hamas als auch Israel zu einem Kompromiss im Gaza-Krieg auf. Sie betonte die Notwendigkeit […]
Probleme mit der Waschmaschine? Das ist für viele eine Katastrophe. Schließlich zählt sie zusammen mit dem Kühlschrank und Staubsauger zu den Must-haves im Haushalt. Umso […]
Die Europawahl 2024 findet am 9. Juni statt, bei der 720 Abgeordnete des Europäischen Parlaments gewählt werden. Deutschland stellt mit 96 Abgeordneten die meisten Mitglieder. […]
In der aktuellen Folge von „Das bringt der Tag“ erklärt die WELT-Nahostkorrespondentin Christine Kensche, wie es in der Krisenregion aussieht und welche Hoffnung es auf […]
Die Maskenpflicht während der Pandemie zu ignorieren kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist möglich, dass Personen, die gegen diese Vorschrift verstoßen haben, noch […]
Die Familienministerin Lisa Paus der Grünen sorgt mit ihren umstrittenen Plänen für die Kindergrundsicherung in der Ampel-Koalition für Konflikte. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten […]
Die Werteunion hat in Thüringen ihren ersten Landesverband gegründet und plant, als konservative Partei rechts von der CDU Stimmen zu gewinnen. Obwohl die Umfragewerte bisher […]
Die Sahel-Zone hat sich zu einem Hotspot des globalen Terrors entwickelt, wo Putsche und Bürgerkriege die Region destabilisiert haben. In Burkina Faso schickt die Junta […]
Bei den Kommunalwahlen in Polen liegt die nationalkonservative Partei PiS laut Prognosen vorne. Die PiS unter der Führung von Jaroslaw Kaczynski erzielte 33,7 Prozent der […]
Die Liberalen planen eine umfassende Reform des Sozialstaats, die Steuererleichterungen für Leistungsträger und zugewanderte Fachkräfte vorsieht. Das Reformpapier, das der WELT vorliegt, enthält auch Verschärfungen […]
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin der FDP, setzt sich mit vollem Einsatz für die Ukraine ein, um ihre Partei vor einem Desaster bei der Europawahl zu bewahren. […]
Am Montag um 9 Uhr findet vor dem Amtsgericht Deggendorf eine Verhandlung gegen den ehemaligen österreichischen Politiker Gerald Grosz statt. Er hatte Einspruch gegen einen […]